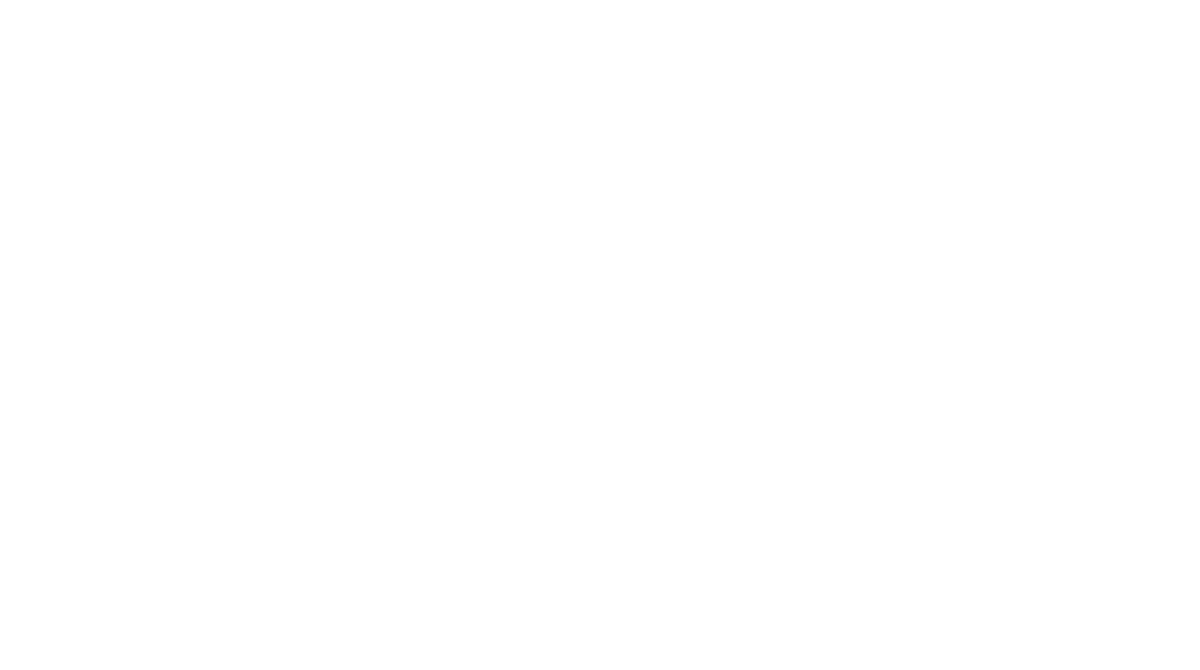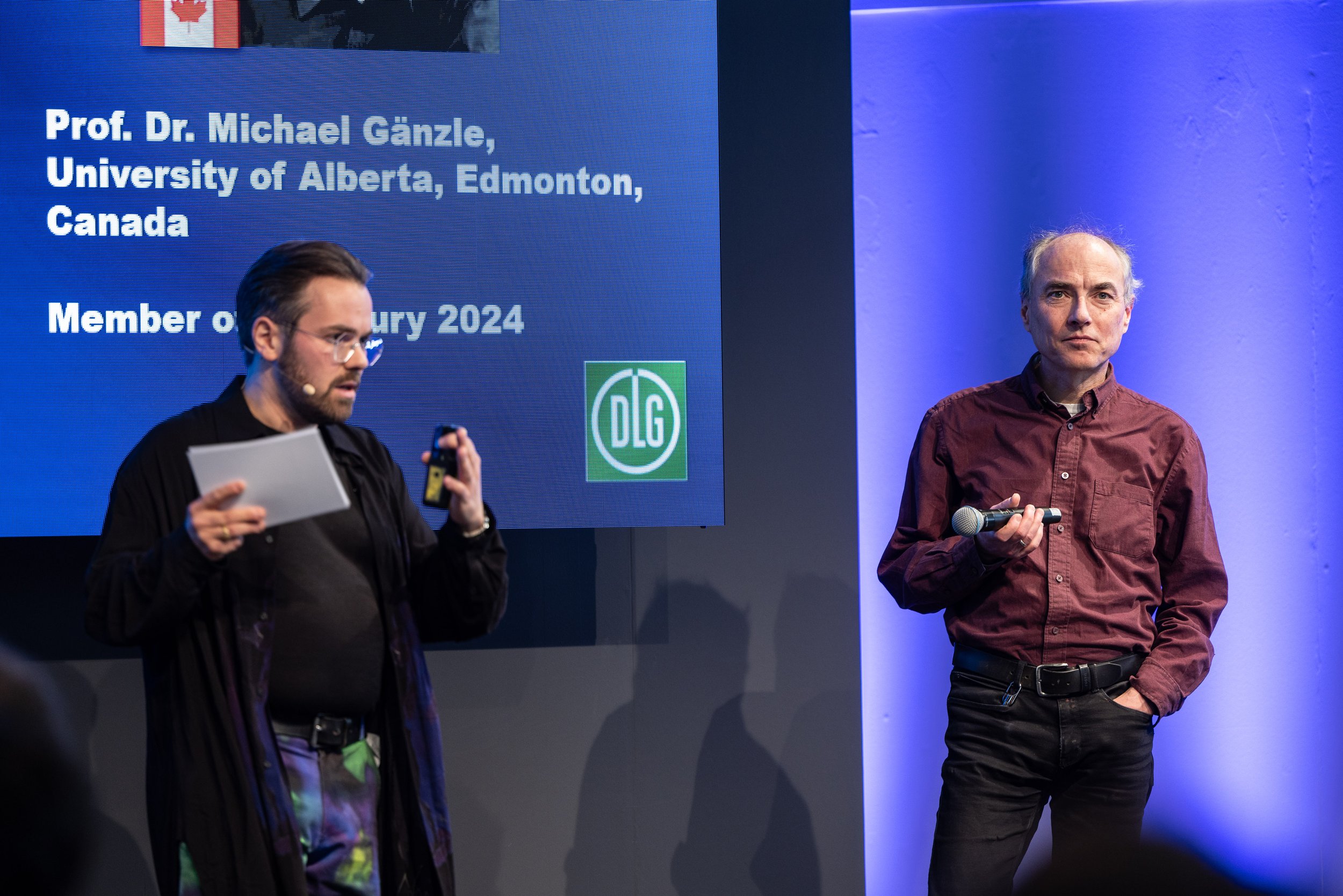Das Interview findet sich auch in der Print-Ausgabe der gvpraxis 10/2024 - Hier als e-paper.
Publizist Hendrik Haase beobachtet seit Jahren, wie Tiktok & Co. das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen – und das nicht nur im Positiven. Das kann auch Folgen für die Schulkantinen haben. Im Interview appelliert er an die Politik und die Gemeinschaftsverpflegung. Was kann getan werden, damit junge Menschen besser geschützt sind und wieder lernen, zu genießen?
GV-Praxis: Bei einer Fachtagung der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung hast du gefordert, dass die junge Generation in der digitalen Welt des Essens nicht allein gelassen werden darf. Was genau ist die Gefahr?
Haase: Neben dem Elternhaus und dem Alltagsleben hat Social Media einen extrem großen Einfluss auf unsere esskulturelle und auch politische Prägung. Mittlerweile weiß man, dass vor allem spaltende, populistische und emotional aufwirbelnde Statements vom Algorithmus gepusht werden – weil dies Klicks und Kommentare verspricht. Die Plattformen sind nicht da, um alle möglichst gut miteinander zu vernetzen, wie es deren Marketing so gerne behauptet, sondern um die Menschen möglichst lange darauf zu halten. Die Menschen bleiben vor allem lange dort, wenn sie sich streiten und berieseln lassen können.
Was bedeutet das in Bezug auf Ernährungs-Themen?
Wir erleben eine Polarisierung. Auf der einen Seite haben wir Gesundheitsgurus, auf der anderen Seite Essstörungs-Fanatiker. Aussagen wie „Milch ist krebserregend“, „Fleisch ist Teufelszeug“ oder „Ich esse ausschließlich Fleisch, glaube nicht den Veganern“, sind Statements, die der Algorithmus pusht und die somit gut funktionieren. Die Gefahr besteht vor allem für junge Menschen. Häufig schauen Sie sich die Inhalte zu lange an bekommen in der Folge immer mehr davon zu sehen und gleiten dadurch in Blasen ab, die ihnen nur Extreme zeigen und eben nicht, wie nachhaltiges Kochen und gesundes Essen geht. Aussagen wie: „Darauf solltest du verzichten“ oder „Das solltest du auf keinen Fall essen“ verunsichern.
Es werden also mit Vorliebe populistische, extreme und negative Inhalte gepusht?
Ja, und wir müssen uns überlegen, was das in den nächsten Jahren mit der Gastronomie-Branche macht und für die Lebensmittel-Welt bedeutet, wenn wir es vor allem mit Food-Fake-News und verdrehten Zahlen zu tun haben. Studien werden nicht mehr sorgfältig abgewogen, stattdessen geht es dann um abstruse Diäten, extreme Ernährungsweisen, nicht nachgewiesene Behauptungen, krasse Bilder. Wir brauchen in Sachen Ernährung wieder eine Versachlichung. Bei polarisierenden Themen fehlt die Einordnung – wer älter ist, kann vielleicht noch die Meta-Ebene einnehmen, aber kleine Kinder und Jugendliche können das nicht.
Um welche Plattformen geht es da konkret – Instagram und TikTok?
Instagram ist bei den sehr jungen Menschen schon kein Thema mehr. Während Cem Özdemir Großflächenplakate für Lebensmittel vor Schulen verbieten will, bleibt einer der gewaltigsten Einflussfaktoren auf die Esskultur nachwachsender Generationen aber unbeachtet: TikTok. Aktuelle Studien legen nahe, dass TikTok enormes Potenzial hat, ungesunde Essgewohnheiten und sogar Essstörungen zu fördern. Von der Glorifizierung des Gewichtsverlusts bis hin zur Verbreitung von Fehlinformationen über Ernährung – diese Inhalte haben bereits jetzt ernsthafte Auswirkungen auf das Essverhalten und die Körperwahrnehmung junger Menschen. Das britische Center for Countering Digital Hate berichtet, dass es weniger als drei Minuten dauert, bis ein neues TikTok-Konto auf problematische Inhalte stößt, die z.B. mit der Normalisierung von Essstörungen in Verbindung stehen. In Deutschland verbringt die Gen Z fast 2 Stunden auf TikTok – und das täglich.
Betrifft diese Problematik nur die Gen Z?
Bei der Gen Z ist es verstärkt. Die Millennials etwa, zu denen ich auch zähle, haben den Ruf sich viel mit Essen zu beschäftigen, aber viel mehr auf der positiven Genuss-Ebene. Eine Studie von Lena Roth an der Universität Gießen hat gezeigt, dass die Gefühle, die Jugendliche von heute haben, die zu viel auf Social Media unterwegs sind, von hoher Negativität geprägt sind. Sie denken, sie ernähren sich nicht richtig und dies geht mit dem Gefühl einher, nicht gut genug zu sein. Essen hat auch ganz viel mit einem Ausdruck der Identität zu tun.
Der Ausdruck von Identität zeigt sich vermutlich auch sehr bei vegan-vegetarischer Ernährung?
Das ist ein gutes Beispiel, wie sehr sich Menschen mit ihrer Ernährung identifizieren, wenn sie von etwas überzeugt sind. Wer vegan lebt, sagt nicht, ich ernähre mich vegan, sondern ich bin vegan. Da geht es darum, sich persönlich auszudrücken. Diese Prägung trifft natürlich das Angebot. Das betrifft dementsprechend auch die Gemeinschaftsgastronomie.
Was kann die Gemeinschaftsgastronomie tun, damit Kinder weiterhin gerne in Kitas und Schul-Mensen essen?
Etwa für Entspannung und für eine gute Beziehung zum Essen sorgen. Das ist nicht einfach, wenn eine Schule beispielsweise 1.500 Menschen versorgen muss. Aber wenn ich weiß, dass da ein gewisses Stresslevel ist, und dass der Genuss bespielt werden sollte, kann ich reagieren. Die Gen Z isst anders als die Generationen da vor. Sie stehen unter höherem Stress. Es muss eine bessere Kommunikation, eine klarere Kommunikation stattfinden. Auch Anfassen, Hören, Riechen, Schmecken gewinnen wieder mehr an Stellenwert – denn wenn die Kinder 3 bis 4 Stunden am Tag TikTok konsumieren, verlieren sie den Bezug zur Realität. Das sollte wiederbelebt werden – zum Beispiel durch Show Cooking und offene Küchen. Wenn ich den Leuten etwas Gesünderes, Nachhaltiges verkaufen will, dann sollte ich es ihnen auch zeigen und sie erleben lassen.
Also sollte die Gemeinschaftsverpflegung sensibilisierend auf junge Menschen wirken?
Auf jeden Fall sollte präsent sein, was da für Menschen zum Essen kommen – mit Essstörungen, oder zumindest anfänglichen Essstörungen oder etwa Menschen mit einem ambivalenten Verhältnis zum Essen.
In den USA diskutiert man mittlerweile über eine systematische Zerstörung der mentalen Gesundheit durch verantwortungslose Plattformen – nicht weil es Digitalisierung gibt, sind Kinder depressiv, aber weil Plattformen darauf optimiert sind, süchtig zu machen und so viel wie möglich genutzt zu werden.
Kinder sollten also möglichst Abstand von TikTok nehmen?
Des Rätsels Lösung ist natürlich auch nicht unbedingt, TikTok zu verbieten. Aber zu verstehen, dass da schon längst ein Algorithmus, eine KI die Inhalte ausspielt. Werbung ist dort kaum von Inhalten zu unterscheiden. Der Algorithmus spricht vor allem auf negativen, polarisierenden Content an und nicht immer auf das, was positiv und faktenbasiert ist. Außerdem ist der Algorithmus auf jeden Nutzenden persönlich zugeschnitten, um die Nutzungsdauer zusätzlich zu erhöhen.
Eine Regulierung wäre also empfehlenswert?
Ja, wir brauchen durchaus eine smarte Regulierung. Wir brauchen einen Einblick in die ganze Maschinerie rund um Social Media und deren Algorithmen, auch wenn mich das vielleicht als naiv straft. Wir müssen uns über die Auswirkungen klar sein, bevor in ein paar Jahren die Gemeinschaftsverpflegung überfordert ist, weil viele Kinder bestimmtes nicht mehr essen wollen oder mangelernährt sind. Die Kinder müssen einen gesunden Umgang mit Social Media lernen. Wir sollten uns zum analogen Raum hinwenden, mit den Kindern in den Schulgarten gehen. Mit den Kindern etwas anbauen und ernten. Gemeinsam kochen. Auch, wenn ich weiß, dass Räumlichkeiten und Personal in Schulen begrenzt sind.
Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Ich habe die Hoffnung, dass wir verstehen: Als Mensch unterscheiden wir uns von Technik, weil wir eben nicht nur aus Einsen und Nullen bestehen, oder Kalorien. Wir sollten unser Körperverständnis nicht zu technologisch werden lassen und verstehen, dass das Orientierungspunkte sind, die uns KI geben kann. Was KI erzeugt sind in der Regel Näherungswerte nicht die allerletzte Wahrheit. Deren neuronale Netzwerke haben (noch) kein wirkliches Weltverständnis. Wir sollten lernen, Technologie so einzusetzen, dass sie uns hilft, gesündere, leckere und vielfältigere Entscheidungen zu treffen.
Also nur die Vorteile der Digitalisierung für uns nutzen und die Nachteile auslassen?
Die Technologie als Werkzeug nehmen, um unsere Welt zu erweitern, sie bunter, vielfältiger, nachhaltiger und effizienter zu machen, das wäre super. Ich würde jungen Menschen gerne so früh wie möglich Genuss und Achtsamkeit auf den Weg geben. Das geht – sie müssen es nur lernen.