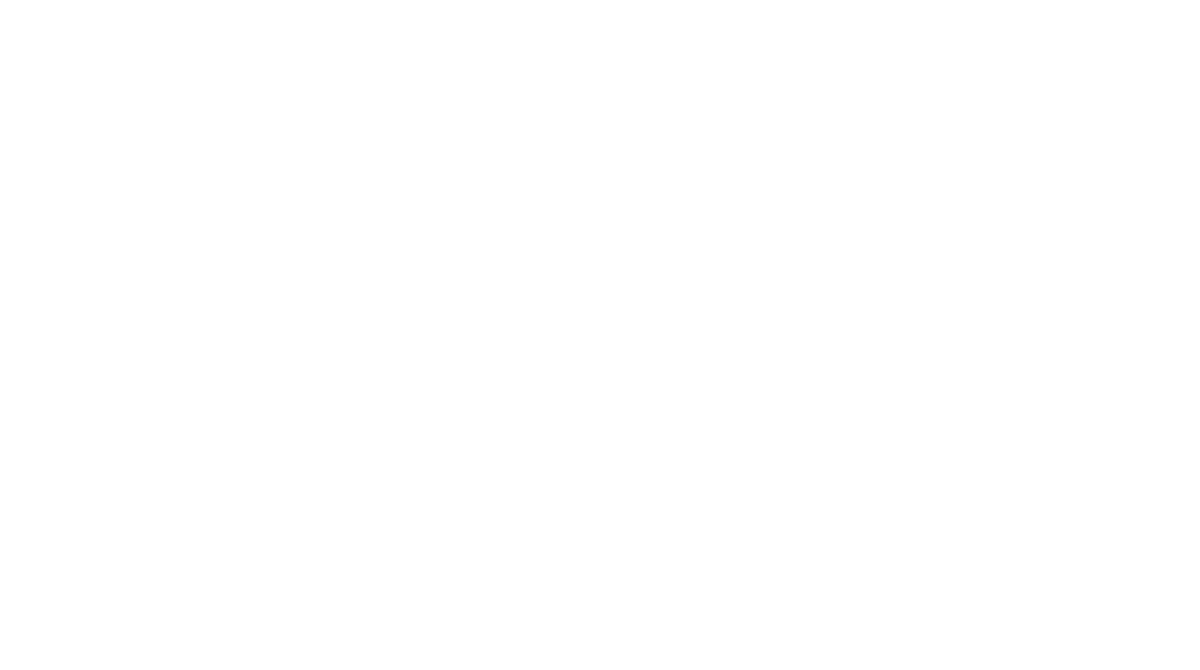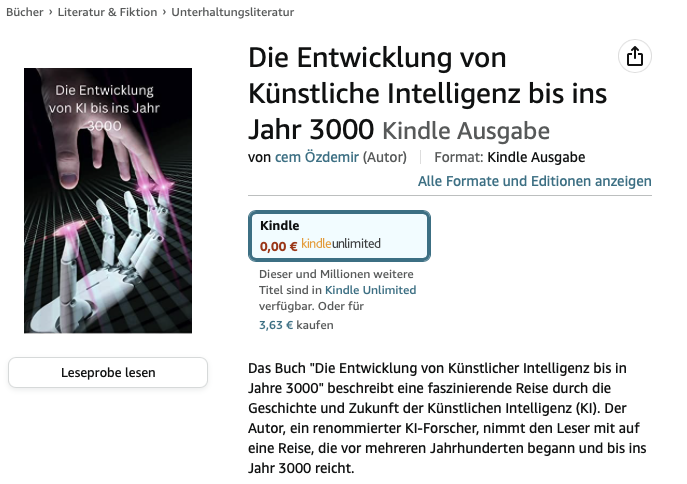1. Fleischfans wird es immer geben. Wie sieht klimabewusster Fleischkonsum aus?
Echte Fleischfans müssen endlich verstehen, dass es nicht um die Größe des Grills oder Dicke der Steaks geht, die am Ende darauf landen. Zum bewussten und tiefergehenden Fleischgenuss gehört heute ein Verständnis für den Zusammenhang von Geschmack, Genetik (Tierrassen), Futter und Nutzung der weltweit verfügbaren Agrarflächen. 70% davon sind als klimagasbindende Graslandschaften nur durch Wiederkäuer nachhaltig nutzbar. Wir brauchen also auch in Zukunft gut und artgerecht gehaltene Tiere. In der Folge eine achtsame Nutzung deren Produkte wie Fleisch und Milch. Das bedeutet allerdings auch weniger (laut DGE ca. ein 1/3 des jetztigen Konsums in Deutschland) dafür bessere tierische Produkte. Wenn wir weiter den Großteil des fruchtbaren Ackerlands für den Anbau von Tierfutter nutzen und damit die falschen Rassen in tierunwürdigen Haltungsbedingungen füttern, stoßen wir schon sehr bald an planetare Grenzen. Davon kann man kein "Fan" sein.
2. Menschen mögen keine Vorschriften. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis, bzw. das Zuviel an Fleisch vom Teller?
Verbote helfen wenig, wenn der Gewinn auf der anderen Seite nicht ersichtlich, in diesem Fall erschmeckbar ist. Gemüse und Hülsenfrüchte müssen zur konkurrenzfähigen Hauptlage gemacht werden, die den Gaumen faszinieren und das Fleisch nicht vermissen lassen. Viele Köch:innen in der GV kommen noch gehörig ins Schwimmen wenn es darum geht das Maximum an Aroma, Textur und Vielfalt aus pflanzlichen Lebensmitteln herauszuholen. Da fehlt es nach wie vor an Know-How, Kreativität und ernsthafter Beschäftigung mit Alternativen, die über das Ordern eines veganen Bratlings, den man kurz in die Friteuse schmeißt, hinausgehen. Die momentane Strategie der Ersatzproduktewelt, Pflanzen wie der Sojabohne oder Erbse erst ihren Eigengeschmack zu entziehen und dann einen artifiziellen Fleischgeschmack mit künstlichen Aromen aufzupfropfen, greift zu kurz und wird am Ende mehr Menschen enttäuschen als überzeugen. Die vielen Spielarten der Fermentation, die Wiederentdeckung von Sortenvielfalt und vergessene oder neuerfundene Handwerkstechniken können dagegen Inspiration für einen innovative Pflanzenküche sein. Pioniere der Root-to-Leaf Küche finden sich immer mehr und sollten ihre Übersetzung in die Welt der Gemeinschaftsverpflegung finden.
3. Sind die Tierlabel-Pläne des Bundesernährungsministeriums zielführend?
Sie können nur ein Anfang sein. Momentan beschreiben sie lediglich den Status Quo der Tierhaltung, die in den meisten Fällen das Tierschutzgesetz bricht und nur mit Ausnahmegenehmigungen existieren kann. Die Frage wird sein ob die EU den deutschen Alleingang akzeptiert und wie die Kennzeichnung und die damit verpflichtenden Kriterien weiter ausgebaut werden (können). Neben der Kennzeichnung, die schon einiges an Ressourcen bindet, fehlt es weiterhin an ausreichenden Kontrollen und einem Finanzierungsmodell für den Umbau der Landwirtschaft. Etwas mehr Platz und frische Luft sind noch kein Garant für mehr Tierwohl in den Ställen, geschweige denn bessere Qualität auf dem Teller. Hier braucht es Mut und Mittel für innovativere Haltungskonzepte, die Tieren ein gesundes und bedarfgesrechtes Leben ermöglichen. Ohne eine entsprechende Verbraucherkommunikation und Vergütung für Produzent:innen wird dies jedoch nicht umzusetzen sein, Kennzeichnung hin oder her.
4. 30 Prozent Öko-Anbaufläche bis 2030 in Deutschland. Ist das realistisch bzw. reicht das überhaupt?
Die Frage ist was das Ziel am Ende sein soll. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die in ihrer ganzen Breite Nachhaltigkeit mit Produktivität in planetaren Grenzen, Vielfalt und Souveränität für Landwirt:innen und Verbraucher:innen verbindet. Bio im jetzigen Format wird das nicht leisten können. Wenn wir also ein "Öko 4.0" auf dem Acker bringen wollen, wie es das Bundesumweltamt rät, braucht es deutlich mehr als lediglich eine Erhöhung des Bio-Anteils. Dieser Wandel muss auch sozial verträglich gestaltet werden. Wer am Tag nur 5 Euro als Bürgergeld für 3 Mahlzeiten zur Verfügung hat wird sich auch in Zukunft kein Bio leisten können.
5. Angesichts des Kriegs in der Ukraine: Wie können wir uns künftig krisenresilienter aufstellen?
Wir sehen, dass eine nachhaltigere Landwirtschaft deutlich weniger abhängig von externen Betriebsmitteln ist, die jetzt fehlen oder absurd teuer geworden sind. Wir sehen, dass eine Landwirtschaft, die auf regionale Strukturen zurückgreifen kann deutlich unabhängiger von globalen Warenströmen ist. Die aktuellen Krisen dürfen nicht dazu führen in alte Muster zurückzufallen sondern sollten uns bestärken den Weg zu einer nachhaltigeren, regional verbundeneren Lebensmittelerzeugung weiter zu forcieren, ohne dabei aus dem Auge zu verlieren, dass wir weltweit verbunden sind. Weitere Konflikte um bald knappe Ressourcen wie Wasser sind sonst schon vorprogrammiert.